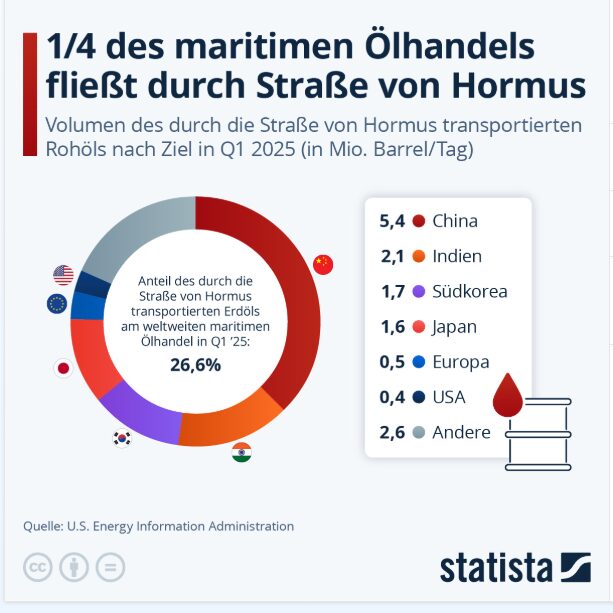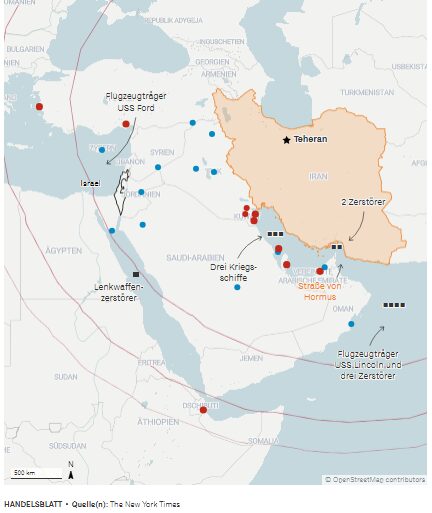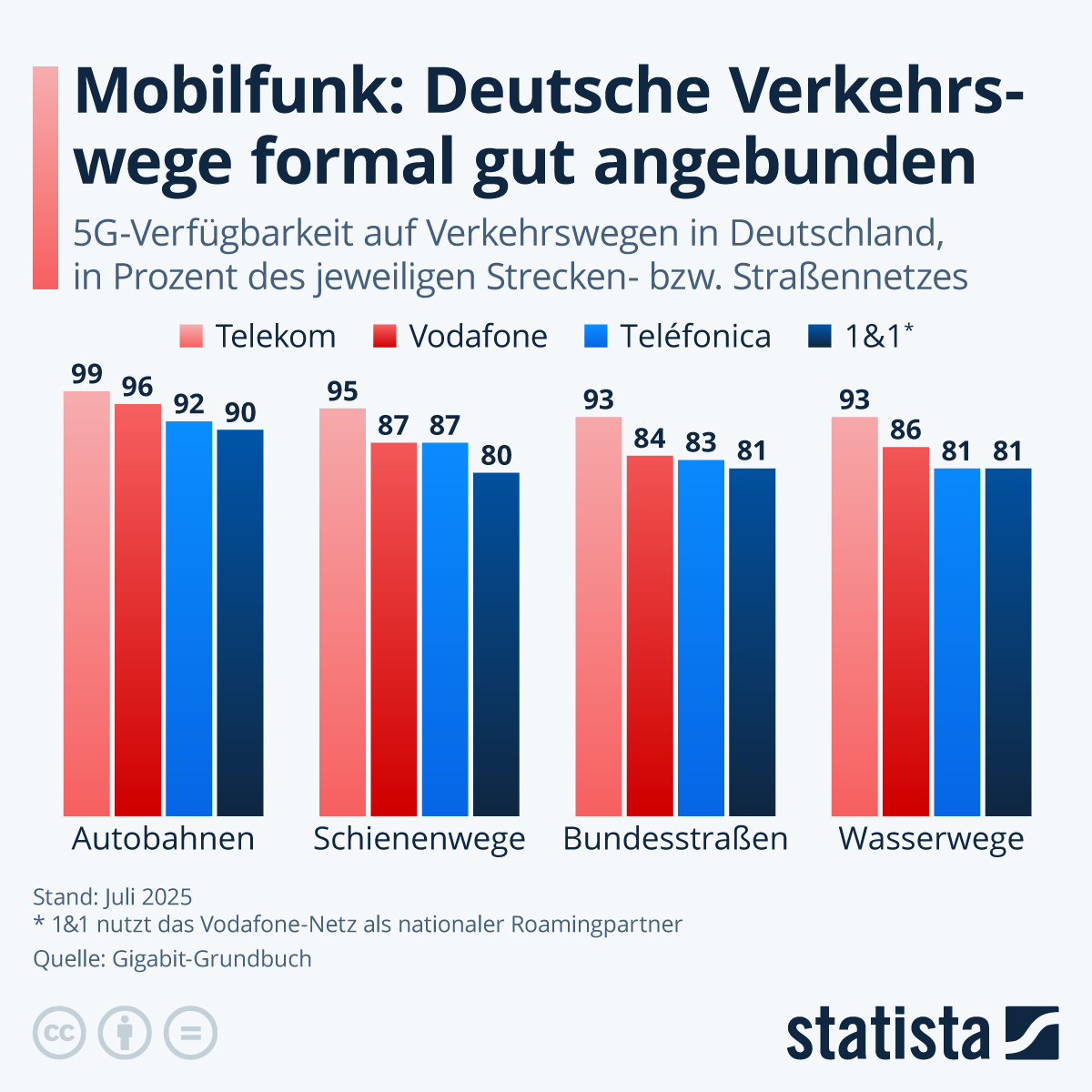Okay, durchatmen und bis zehn zählen. Ja, die Berlinale hat es wieder nicht geschafft. Wieder war die Verdammung Israels das Thema von Presskonferenzen, offenen Briefen und auch der Abschlussgala. Wieder haben sogenannte pro-palästinensische Aktivisten im Namen der Mitmenschlichkeit ihren Anti-Humanismus offenbart.
Der Gewinner des diesjährigen Spielfilmdebüt-Preises hat sogar der ganzen Welt gedroht, falls das überhaupt jemand mitbekommen hat beim beklatschten Palästinenserfahneschwenken: »Wir werden uns an jeden erinnern, der an unserer Seite stand, und wir werden uns an jeden erinnern, der gegen uns war.«
Der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Alkhatib scheint so von kaltem Hass und Rachegefühlen getrieben - was man in Interviews erleben konnte -, dass die Frage gestattet sein muss, ob er seinen Film »Chronicles from the Siege« - abgesehen vom Abspann - eigentlich selbst gemacht hat, der mit Härte, aber vor allem Universalität, Empathie und Menschlichkeit davon erzählt, was eine Belagerung mit Menschen macht.
Aber es soll weder um den durchaus guten Film noch um seinen weltverachtenden Macher gehen. Beide werden vergessen sein. Denn wie Berlinale-Jurypräsident Wim Wenders sagte: »Was auch immer wir ohne Liebe tun, wird keinen Bestand haben«.
Auch die Hollywoodgrößen, die meinten, dass sie die Berlinale angreifen und ihr Zensur und Genozid-Komplizenschaft vorwerfen müssen, können wir getrost ignorieren. Im vergangenen Jahr waren es 1800, jetzt waren es nur noch 80. Die bekannten Namen waren an einer Hand abzuzählen.
Nein, die Masche zieht nicht mehr. Zu durchschaubar ist die Bigotterie, wenn Menschenrechte gepredigt und im gleichen Atemzug »Genozid« und »Boykott« geschrien wird.
Berlinale-Chefin Tricia Tuttle stand übrigens wenige Stunden vor der Bären-Verleihung bei einer Veranstaltung voller Liebe, Hoffnung und Resilienz auf der Bühne, um das neue Ende des Films »A Letter to David« zu feiern, das von der Rückkehr der israelischen Geiseln David und Ariel Cunio berichten darf. Für ihn sei der Film ein Zeugnis all der Menschen, »die mich in den zwei Jahren, als ich in Gefangenschaft war, nicht aufgegeben haben«, so David Cunio.